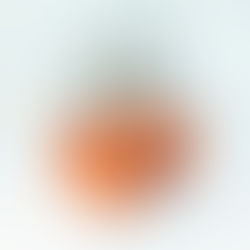

30. Mai 20254 Min. Lesezeit


21. Mai 20254 Min. Lesezeit
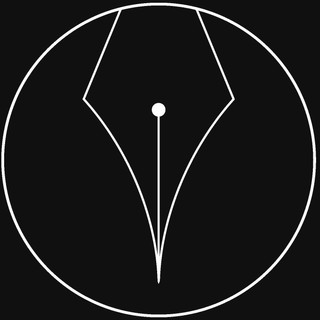
Aktualisiert: 26. Aug. 2025
Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der Grausamkeiten. Kaum eine Epoche kam ohne brutale Hinrichtungsarten aus, die nicht nur der Bestrafung, sondern auch der Abschreckung dienen sollten. Eine der qualvollsten und zugleich eindrücklichsten Methoden war das Sieden – die Exekution durch lebendiges Kochen in Wasser, Öl, Pech oder anderen Flüssigkeiten. Diese Strafe, die heute kaum vorstellbar wirkt, war im Mittelalter und der frühen Neuzeit in Europa, Asien und Teilen des Nahen Ostens eine real praktizierte Form der Todesstrafe.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Ursprünge, die Durchführung, die juristische Bedeutung und die kulturellen Spuren dieser Hinrichtungsart. Dabei zeigt sich, dass das Sieden nicht nur ein Akt der Gewalt war, sondern auch ein Spiegelbild der damaligen Gesellschaften, ihrer Moralvorstellungen und ihrer Ängste.
Das Sieden als Hinrichtungsmethode hat seine Wurzeln vermutlich in der Antike. Schon die Babylonier und Assyrer sollen Menschen in siedendem Wasser oder Öl getötet haben. Der römische Historiker Valerius Maximus berichtet, dass Verräter und Giftmischer im heißen Öl gebraten wurden.
Der symbolische Hintergrund war klar: Reinigung durch Feuer und Wasser. In vielen Kulturen galt das Kochen im Wasser als eine Art „Läuterung“, während das Öl oder Pech den Aspekt der Strafe und Qual verstärkte. Anders als bei Enthauptungen oder Erschießungen, die schnell und relativ schmerzlos waren, stand beim Sieden das Leiden im Mittelpunkt.
Die Durchführung war so grausam wie simpel. Der Verurteilte wurde entweder:
In einen bereits kochenden Kessel gestoßen, sodass er sofort verbrüht wurde, oder
Langsam in kaltes Wasser oder Öl gesetzt, das dann erhitzt wurde – ein Prozess, der besonders qualvoll und langwierig war.
Die Flüssigkeiten variierten je nach Region und Verfügbarkeit:
Wasser war die einfachste Form, oft bei weniger schwerwiegenden Verbrechen.
Öl verstärkte den Schmerz, da es an der Haut haftete und tiefer eindrang.
Pech oder Teer war besonders grausam, da es die Haut verklebte und das Atmen erschwerte.
Oft wurde der Kessel auf einem Marktplatz aufgestellt, sodass die Hinrichtung öffentlich und für alle sichtbar war. Zuschauer sollten so vor ähnlichen Verbrechen gewarnt werden.
Unter König Heinrich VIII. wurde das Sieden als Strafe für Giftmischer eingeführt. 1531 erließ er ein Gesetz, das bestimmte: Wer Lebensmittel oder Getränke vergiftete, sollte „lebendig in siedendem Wasser gekocht werden“. Dieses Gesetz war eine Reaktion auf mehrere Giftanschläge am Hof.
Ein bekanntes Opfer war Richard Roose, der 1531 in Smithfield (London) in einem großen Kessel mit kochendem Wasser hingerichtet wurde. Zeitzeugen berichten, dass die Menschenmenge entsetzt, aber auch fasziniert zusah.
In Deutschland, den Niederlanden und Frankreich wurde das Sieden ebenfalls angewandt, meist bei Falschmünzern. Das Herstellen von falschem Geld galt als besonders gefährliches Verbrechen, da es die Stabilität des Staates bedrohte. Deshalb wurde es mit extremen Strafen wie dem Kochen oder dem lebendigen Verbrennen geahndet.
In Augsburg (16. Jahrhundert) sind Berichte über Falschmünzer überliefert, die im siedenden Öl hingerichtet wurden.
Auch in asiatischen Kulturen tauchte das Sieden auf. In der Mongolei etwa soll Dschingis Khan Feinde in siedendem Öl töten lassen haben. Im Persischen Reich wurden Rebellen und Verräter auf ähnliche Weise bestraft.
Die grausame Logik hinter dem Sieden war weniger die „Gerechtigkeit“ für den Täter, sondern die abschreckende Wirkung. In einer Zeit, in der viele Menschen analphabetisch waren und Gesetzestexte kaum verbreitet wurden, funktionierte das Strafrecht vor allem durch sichtbare und unvergessliche Beispiele.
Ein Mensch, der vor den Augen der Gemeinschaft im Kessel starb, brannte sich in das kollektive Gedächtnis ein. Gleichzeitig wurde die Macht des Herrschers oder Staates inszeniert – wer gegen die Ordnung verstieß, musste mit den schlimmsten Qualen rechnen.
Das Sieden hatte auch eine symbolische Ebene. Wasser galt in vielen Religionen als Element der Reinigung. Doch wenn es kochte, wurde es zum zerstörerischen Gegenspieler. Öl und Pech hatten zusätzlich eine „dämonische“ Bedeutung: Sie erinnerten an Höllenqualen, an brennende Flüsse und die Folter der Verdammten.
Manche Chronisten berichten, dass die Zuschauer beim Sieden an das Fegefeuer erinnert wurden – eine irdische Vorwegnahme der göttlichen Strafe. So verband sich die weltliche Justiz mit religiöser Symbolik.
Obwohl das Sieden als Strafe lange angewandt wurde, gab es auch Kritiker. Schon im 16. Jahrhundert äußerten Humanisten wie Erasmus von Rotterdam Zweifel, ob solch barbarische Methoden gerechtfertigt seien. Sie sahen darin eher eine Befriedigung der Sensationslust des Publikums als eine echte Form der Gerechtigkeit.
Mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert und der Verbreitung moderner Rechtsstaatlichkeit verschwanden das Sieden und ähnliche Strafen zunehmend. Juristen wie Cesare Beccaria argumentierten, dass Strafen zwar notwendig seien, aber niemals grausam und unmenschlich.
Im Laufe der Neuzeit wurde das Sieden schrittweise abgeschafft. In England verschwand die Strafe nach dem Tod Heinrichs VIII. wieder. Auf dem europäischen Kontinent hielten sich Fälle bis ins 17. Jahrhundert, doch mit der Reform des Strafrechts im 18. und 19. Jahrhundert galt sie endgültig als überholt.
Heute erscheint die Vorstellung, Menschen zu kochen, wie ein grausames Relikt aus einer anderen Welt. Doch sie verdeutlicht, wie stark sich Recht, Moral und Menschlichkeit in den letzten Jahrhunderten entwickelt haben.
Interessanterweise hat das Sieden auch sprachliche Spuren hinterlassen. Redewendungen wie „jemanden in der Suppe kochen“ oder „in der Hölle sieden“ stammen aus der Vorstellung, dass das Kochen eine ultimative Strafe sei.
Auch in Literatur und Kunst taucht das Motiv auf. Dante beschreibt in seiner „Göttlichen Komödie“ Sünder, die in siedenden Flüssigkeiten gequält werden. Maler der Renaissance griffen das Thema ebenfalls auf, oft mit biblischem Bezug.
Das Sieden reiht sich ein in eine lange Liste grausamer Strafen:
Rädern – das Zerschlagen der Glieder auf einem Rad.
Vierteilen – das Zerreißen durch Pferde.
Pfählen – das Aufspießen auf einen langen Holzpfahl.
Im Unterschied zu diesen Methoden hatte das Sieden jedoch eine besonders intensive sinnliche Dimension: das Zischen des Wassers, der aufsteigende Dampf, der Geruch von verbrannter Haut – all das machte die Exekution noch drastischer.
Das Sieden als Hinrichtungsart ist ein dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte. Es zeigt, wie eng Rechtsprechung, Religion, Symbolik und öffentliche Inszenierung miteinander verbunden waren.
Heute wirkt es barbarisch, doch für die Menschen des Mittelalters und der frühen Neuzeit war es eine logische Konsequenz einer Welt, in der Strafen sichtbar, schmerzhaft und abschreckend sein mussten.
Gleichzeitig macht die Geschichte dieser Strafe bewusst, wie wichtig die Entwicklung von Menschenrechten und humaner Rechtsprechung ist. Denn das, was wir heute als unvorstellbare Grausamkeit ansehen, war einst gelebte Realität.
Antike (ca. 600 v. Chr.) – In babylonischen und assyrischen Quellen wird das Sieden als Strafe für Verräter und Rebellen erwähnt.
3. Jahrhundert n. Chr. – Römische Quellen berichten, dass christliche Märtyrer angeblich in siedendem Öl getötet wurden (z. B. die Legende des Apostels Johannes, der jedoch wundersam überlebt haben soll).
13. Jahrhundert – Dschingis Khan soll Gegner in siedendem Öl hinrichten lassen haben.
15. Jahrhundert – In Frankreich und den Niederlanden wurden Falschmünzer öffentlich gekocht.
1531 (England) – Richard Roose, ein Koch, wurde in Smithfield, London, im Auftrag Heinrichs VIII. lebendig gekocht, nachdem er eine Suppe vergiftet hatte.
1542 (England) – Margaret Davy wurde als Falschmünzerin in einem Kessel mit kochendem Wasser exekutiert – eine der letzten bekannten Anwendungen in England.
17. Jahrhundert (Deutschland) – In Augsburg und Köln gab es Fälle, bei denen Falschmünzer in siedendem Öl oder Wasser hingerichtet wurden.
18. Jahrhundert – Mit der Aufklärung verschwindet das Sieden in ganz Europa endgültig aus den Gesetzbüchern.
Hinrichtungsart | Durchführung | Symbolik | Dauer des Leidens | Ziel / Wirkung |
Sieden | Opfer wird in kochendes Wasser/Öl/Pech getaucht | Reinigung, Höllenstrafe, Abschreckung | Minuten bis über eine Stunde | Schock, öffentliches Spektakel |
Rädern | Zerschlagen der Glieder, Aussetzen auf Rad | Zerstörung des Körpers, Demütigung | Stunden bis Tage | Abschreckung, Zurschaustellung |
Verbrennen | Opfer an Pfahl gebunden und verbrannt | Reinigung durch Feuer, religiöse Symbolik | 15–30 Minuten | Exempel, besonders bei „Hexerei“ |
Pfählen | Opfer auf Pfahl gespießt, Tod durch inneres Zerreißen | Durchbohrung = ultimative Demütigung | Stunden bis Tage | Grauen erzeugen |
Vierteilen | Opfer von Pferden auseinandergerissen | Vollständige Zerstörung, Auflösung der Person | Minuten (nach Quälerei) | Strafe für Hochverrat |
Enthauptung | Kopf mit Schwert oder Axt abgeschlagen | Relativ „ehrenvoll“ | Sekunden | Schneller Tod, symbolische Gerechtigkeit |

Primär- und Zeitquellen
Statutes of Henry VIII (1531): Gesetz über das Kochen von Giftmischern.
Valerius Maximus, Factorum ac dictorum memorabilium libri IX: Erwähnungen von Strafen in Rom.
Zeitgenössische Chroniken aus Augsburg und Köln (16./17. Jahrhundert) über Falschmünzer.
Sekundärliteratur
Gatrell, V. A. C.: The Hanging Tree: Execution and the English People 1770–1868. Oxford 1994.
Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main 1977.
Evans, Richard J.: Rituals of Retribution: Capital Punishment in Germany 1600–1987. Oxford 1996.
Friedland, Paul: Seeing Justice Done: The Age of Spectacular Capital Punishment in France. Oxford 2012.
Online-Ressourcen
British Library: Dokumente zum Fall Richard Roose (1531).
European History Primary Sources (EHPS): Sammlung zu Strafen im Mittelalter.
The National Archives (UK): Gesetzestexte zu Hinrichtungsarten.
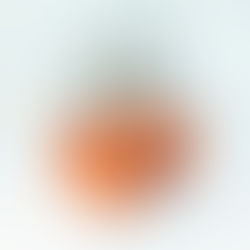






Kommentare