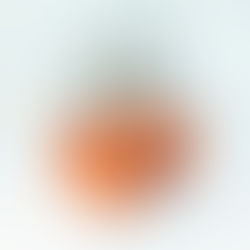

30. Mai4 Min. Lesezeit


21. Mai4 Min. Lesezeit
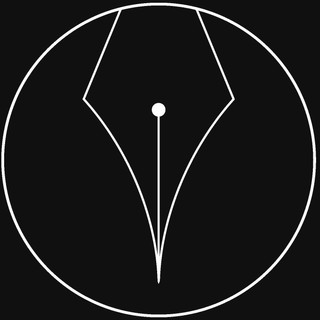
Es gibt Nächte, in denen man den Klang hört, bevor man das Bild sieht. Ein dumpfer Schlag. Metall auf Holz. Und dann – Stille.
Ich weiß nicht mehr, wann ich zum ersten Mal von der Guillotine erfuhr. Vielleicht war es ein Schulbuch, vielleicht ein Film. Was mir blieb, war kein klares Bild, sondern ein Gefühl: die Vorstellung, dass ein Akt, so grausam und endgültig wie der Tod, in einen präzisen Handgriff verwandelt werden konnte. Fast hygienisch. Fast bürokratisch.
Was mich seither beschäftigt, ist nicht nur die Brutalität der Maschine, sondern die Idee dahinter: dass man den Tod rationalisieren kann. Dass man Leiden vermessen, menschliche Würde standardisieren, Gerechtigkeit in Stahl pressen kann. Vielleicht war das der wahre Schock: nicht das Blut, sondern die Kälte, mit der es vergossen wurde.
Die Guillotine ist kein bloßes Relikt der Vergangenheit. Sie ist ein Denkmal der menschlichen Ambivalenz – zwischen Fortschritt und Grausamkeit, zwischen Idealismus und Angst. Sie ist der Moment, in dem Vernunft und Tod ein Bündnis eingingen.

Als Joseph-Ignace Guillotin 1789 seine berühmte Rede vor der Nationalversammlung hielt, geschah das nicht mit Blutdurst, sondern mit dem Idealismus eines Humanisten. Er forderte eine gleichmäßige, schnelle, schmerzfreie Hinrichtungsmethode – unabhängig von Stand oder Vermögen.
Zuvor war die Hinrichtungspraxis in Frankreich zutiefst sozial geprägt: Adlige wurden mit dem Schwert enthauptet, eine „ehrenvolle“ Methode. Das einfache Volk wurde erhängt, gerädert, verbrannt oder gevierteilt. Die Idee einer einheitlichen Hinrichtungsform schien revolutionär – im buchstäblichen wie ideologischen Sinn.
Die technische Ausführung der Guillotine übernahm nicht Guillotin selbst, sondern Dr. Antoine Louis, ein angesehener Chirurg. Gemeinsam mit dem deutschen Handwerker Tobias Schmidt entwickelte er 1792 eine Maschine mit einer schrägen, fallenden Klinge – einfach zu bedienen, effizient und zuverlässig.
Die Guillotine war eine Maschine der Präzision:
Eine ca. 40 kg schwere, schräge Klinge wurde durch zwei senkrechte Führungsschienen gehalten und aus etwa zwei Metern Höhe fallen gelassen.
Die Geschwindigkeit betrug etwa 21 m/s, was bedeutete, dass der Hals innerhalb von 0,1 bis 0,2 Sekunden durchtrennt wurde.
Der Kopf fiel in einen bereitgestellten Korb, während der Körper oft noch wenige Sekunden zuckte.
Trotz der Effizienz blieb die Frage nach dem Bewusstsein nach der Enthauptung lange umstritten. Neurowissenschaftliche Studien wie jene von Dr. Harold Hillman (1993) legen nahe, dass das Gehirn nach der Trennung vom Körper für einige Sekunden funktionsfähig bleibt. Berichte über blinzelnde, röchelnde oder rot werdende Köpfe befeuerten diesen Mythos.
Die Guillotine trat in die Geschichte ein wie ein Schauspieler auf eine Blutbühne: Mit einem Paukenschlag.
Während der Französischen Revolution wurde sie zum Symbol der Gleichheit – und später des Terrors. Zwischen 1793 und 1794 fielen unter der Herrschaft der Jakobiner täglich Köpfe. Über 16.000 Menschen wurden während der „Terreur“ hingerichtet, darunter:
König Ludwig XVI. (21. Januar 1793)
Königin Marie-Antoinette (16. Oktober 1793)
Georges Danton, einstiger Revolutionär (April 1794)
Und schließlich Maximilien Robespierre, Architekt des Terrors (28. Juli 1794)
Die Guillotine stand prominent auf dem Place de la Révolution, wo sie beinahe zum Alltagsbild wurde. Gassenhändler verkauften „Guillotine-Souvenirs“, Kinder sangen Reime über rollende Köpfe, und viele Pariser besuchten die Hinrichtungen wie Theateraufführungen.
Die Hinrichtung war kein bloßer Akt – sie war Inszenierung. Vom Verlesen des Urteils über den letzten Gang des Delinquenten bis hin zum Fall der Klinge folgte alles einem klaren Skript. Die Hinrichtung war öffentlich, sichtbar, lehrreich – eine Mahnung an das Volk.
Der Beruf des Henkers wurde zur Wissenschaft: Die Dynastie der Sanson-Henker, die über sechs Generationen die Pariser Hinrichtungen durchführten, beschrieb in Tagebüchern minutiös Technik, Körperverhalten und psychologische Aspekte des Tötens.
Und doch blieb das Trauma nicht aus. Augenzeugen berichteten von Schreien, Ohnmachten und „Gesichtern, die ihre Köpfe verloren, aber nicht ihren Ausdruck“.
Selbst nach dem Ende des revolutionären Terrors blieb die Guillotine das offizielle Vollstreckungsinstrument der französischen Justiz – über 180 Jahre lang.
Unter Napoleon wurden politische Gegner geköpft.
Im 19. Jahrhundert nutzte man sie gegen Mörder, Banditen und Anarchisten.
Noch im 20. Jahrhundert wurde sie regelmäßig eingesetzt:
Eugène Weidmann, ein Serienmörder, war 1939 das letzte Opfer einer öffentlichen Hinrichtung. Der Skandal – Menschen filmten, lachten und drängelten – führte dazu, dass alle folgenden Exekutionen hinter Gefängnismauern stattfanden.
Hamida Djandoubi, ein tunesischer Mörder, war 1977 das letzte Opfer der Guillotine in Frankreich – und zugleich der letzte Mensch in Westeuropa, der per Enthauptung hingerichtet wurde.
Erst 1981 wurde die Todesstrafe unter Präsident François Mitterrand offiziell abgeschafft. Die Guillotine verschwand – leise, wie ein Schatten.
Die Guillotine lebt weiter – in Literatur, Film, Philosophie.
In Victor Hugos Werk „Der letzte Tag eines Verurteilten“ wird sie zum Inbegriff moderner Grausamkeit.
Michel Foucault sieht in ihr den Beginn eines neuen Zeitalters staatlicher Macht: nicht mehr durch Folter, sondern durch „sichtbaren, effizienten Tod“.
In der Popkultur erscheint sie in Serien, Comics, Musikalben – von The Scarlet Pimpernel bis Iron Maiden.
Psychologisch wird die Guillotine oft als Ausdruck des Versuchs gesehen, das Unkontrollierbare – den Tod – zu beherrschen. Wissenschaftlich, technisch, logisch. Doch wie rational kann ein Akt sein, der Leben beendet?
Die Guillotine war ein Widerspruch in sich. Sie war Produkt einer aufgeklärten Gesellschaft – und wurde doch zum Werkzeug eines blutigen Terrors. Sie war präzise, sauber, effizient – und dennoch furchteinflößend brutal.
In ihr spiegelt sich die ewige Frage menschlicher Macht: Können wir Gerechtigkeit schaffen, ohne selbst zu Tätern zu werden? Kann man Humanität konstruieren – oder ist jede Todesmaschine letztlich auch eine seelische?
Die Guillotine ist Geschichte. Doch das, was sie verkörpert – der Versuch, Schmerz zu ordnen, Tod zu kontrollieren – bleibt eine offene Rechnung.

Doyle, William. The Oxford History of the French Revolution. Oxford University Press, 1989.
Foucault, Michel. Überwachen und Strafen. Suhrkamp Verlag, 1976.
Hillman, Harold. “The possible pain experienced during execution by different methods.” Perception, 1993.
Hughes, Robert. Fatal Shore. Vintage Books, 1988.
Bell, David A. The First Total War: Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare as We Know It. Houghton Mifflin, 2007.
French National Archives: Documentation sur les exécutions capitales, 1792–1977.
BBC History. “The Guillotine and the French Revolution.” (www.bbc.co.uk/history)
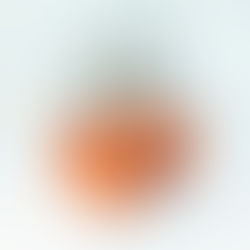






Kommentare